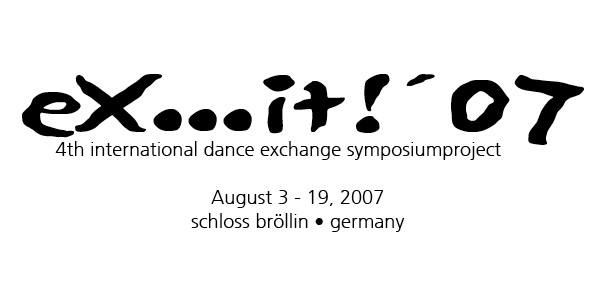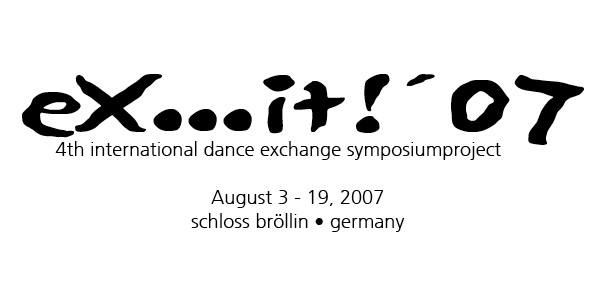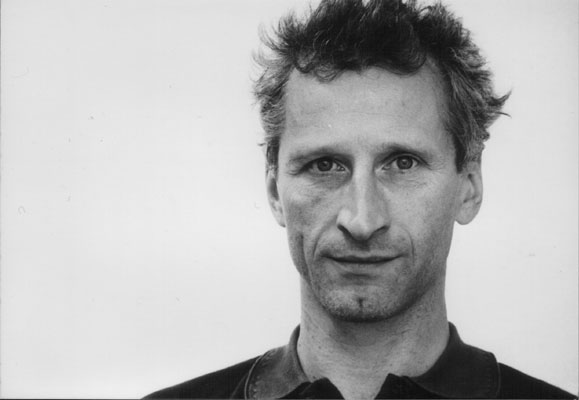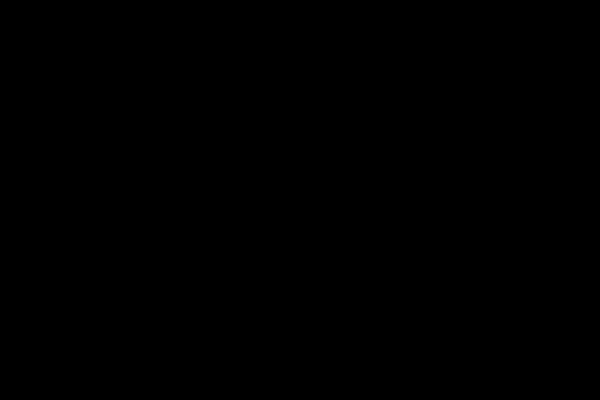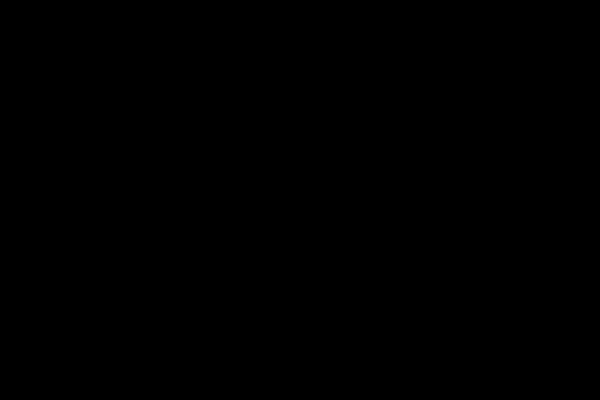Symposium
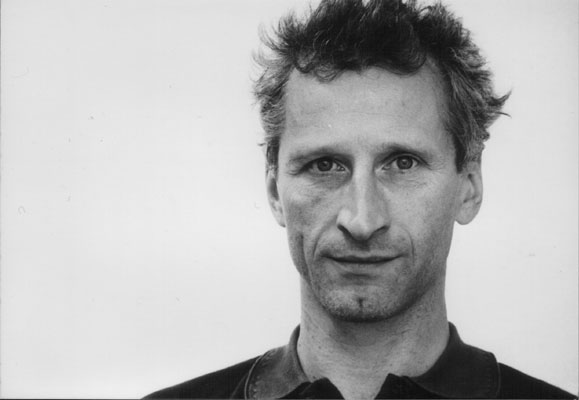
|
Gregor Weber
(Moderation des Symposiums)
Gregor Weber studierte bei Anzu Furukawa und arbeitet heute als
Tänzer, Choreograph und Regisseur für Theater,
Workshop-Projekte und Events.
Er ist Gründer der Gruppe G.W.pulpennah.
|
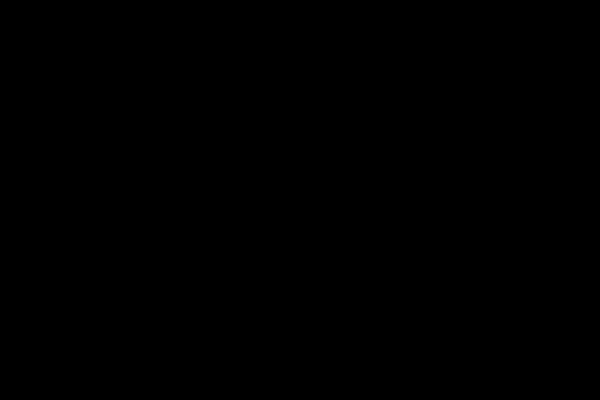
|
Gilles Kennedy
Gilles Kennedy is Autorin und
Journalistin verschiedener Bücher und Artikel über Performing
Arts, speziell Tanz und hier insbesondere Butoh.
|
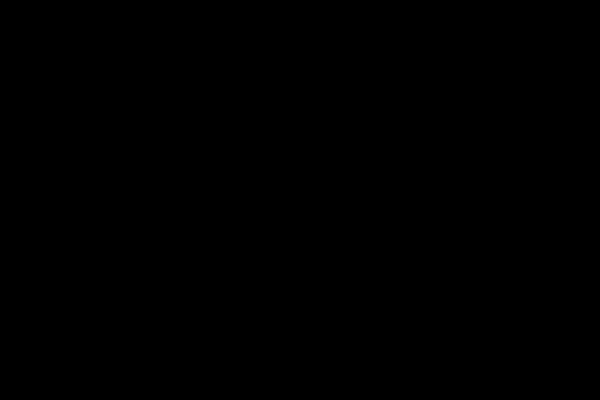
|
Akiko Tachiki
Tanzkritikerin und Journalistin
Lebt und
arbeitet in Japan und schreibt für japanische Magazine, aber auch
als Japan-Korrespondentin für europäische Magazine, wie z.B.
"Ballet Tanz".
|
Multimoderne Tanzentwicklung – Der Fall Butoh
Text: Rolf Elberfeld
Der
Export des europäischen Kunstsystems in die verschiedensten
Länder der Erde ist ein zentrales Beispiel, um die Frage nach
verschiedenen Modernen zu konkretisieren. Es gibt nicht nur rund um den
Globus verschiedene Symphonieorchester, sondern auch Galerien für
„moderne“ Malerei, die sich jeweils an den Standards in Europa oder den
USA orientieren. Dabei ist jedoch die Aufnahme der europäischen
Musik und Malerei in Japan anders verlaufen als in Indien, in Nigeria
anders als in Indonesien, in Brasilien anders als in Ägypten. In
allen Ländern, die jeweils eine eigene Tradition der Künste
besessen haben, sind inzwischen Neuverbindungen entstanden, die das
Profil der jeweiligen Moderne mitgestalten.
Im Rahmen verschiedener Künste können wir beobachten, wie das
aus Europa Importierte auf die jeweiligen Traditionen trifft und dort
Verschiedenes auslöst. Die Wirkungen reichen von der radikalen
Verdrängung, Wiederentdeckung, und Neuaneignung älterer
Traditionen bis zur Schaffung neuer Synthesen, die sich weder eindeutig
auf eine ältere Kultur noch einfach auf Europäisches
zurückführen und reduzieren lassen. Zudem läßt
sich beobachten, daß sowohl europäische wie auch
traditionelle Kunstauffassungen ungestört nebeneinander existieren
können und somit das System der Künste selbst erheblich
erweitert und modifiziert wird. Vor diesem Hintergrund kann die Frage
nach den Künsten und ihrer Interpretation im Rahmen der
Multimodernität nicht mehr nur von Europa ausgehen. Es müssen
zumindest ansatzweise die Vorstellungen von den Künsten in
älteren Traditionen in den Blick gebracht werden, um die
multimoderne Neuordnung und -ausrichtung der Künste in den
verschiedenen Modernen zu thematisieren.
Durch die weltweite Ausbreitung des europäischen Kunstsystems im
Rahmen kolonialer Eroberungen, verbreiteten sich auch europäische
Formen des Tanzes und seine Aufführungspraktiken in verschiedenen
Kulturen und Modernen. In Reaktion darauf und in Absetzung dazu
entstanden neue Formen des Tanzes wie das Butoh in Japan. Diese
modernen Tanzformen in verschiedenen außereuropäischen
Modernen zeichnen sich häufig dadurch aus, daß in ihnen aus
der Tradition überlieferte Bewegungen neu überformt wurden
und daraus eigenständige moderne Entwicklungen des Tanzes
resultieren. In diesen Entwicklungen ist zu beobachten, daß die
Leiblichkeit als symbolische Form grundsätzlich in
verschiedenkultureller Perspektive thematisiert wird. Ähnlich wie
der moderne Tanz in Europa und den USA aus einer reflexiven Reaktion
auf ältere europäische und außereuropäische
Bewegungsformen entstanden ist, so wurde und wird in Japan, Taiwan,
China, Indien, Senegal, Brasilien und in vielen anderen Modernen –
zumeist im Zusammenhang mit den europäischen und US-amerikanischen
Entwicklungen –, die jeweils eigene Tradition auf neue und moderne
Weise angeeignet. Die aus diesem Prozeß entstandenen Tanzmodernen
lassen sich nicht mehr nach dem Schema Tradition auf der einen und
europäische Moderne auf der anderen Seite verstehen, wie vor allem
das Beispiel Butoh immer wieder zeigt. Für den modernen Tanz
bedeutet dies, daß die jeweils ältere kulturelle Tradition
der in Frage stehenden Moderne studiert werden muß, um die
Tanzentwicklung der jeweiligen Moderne zu erschließen. In jeder
Moderne steht auch die Leiblichkeit als symbolische Form auf dem
Hintergrund der älterer Bewegungskulturen der eigenen Tradition,
der importierten Bewegungsformen und der Rezeption der eigenen
Entwicklungen in anderen Modernen in grundsätzlicher Weise zur
Disposition. Es geht dabei jeweils um den Gesamtzusammenhang von
Mensch, Menschen, Dingen und Welt. Ohne einfach in ein relativistisches
Schema zu verfallen, entwickeln sich so verschiedene Weisen der
Wirklichkeitsformung, die sich nicht auf ein Grundschema reduzieren
lassen, sondern Wirklichkeit jeweils in eigener Weise auf der Ebene des
Leibes zugänglich machen.
(Vgl.: Rolf Elberfeld,
Multimodernität. Vielheit der Modernen und die Freiheit der
Künste, in: Positionen. Beiträge zur neuen Musik, Themenheft
„Migration“, 63:2005, 2-10)